Michael Bakunin: Die revolutionäre Frage. Föderalismus – Sozialismus – Antitheologismus, aus dem Franz. v. Michael Halfbrodt, hrsg. v. Wolfgang Eckhardt, Münster: UNRAST-Verlag, 2000 (= Klassiker der Sozialrevolte, hrsg. v. Jörn Essig-Gutschmidt; 6), ISBN 3-89771-903-7, 179 Seiten.
Rezension von Markus Henning
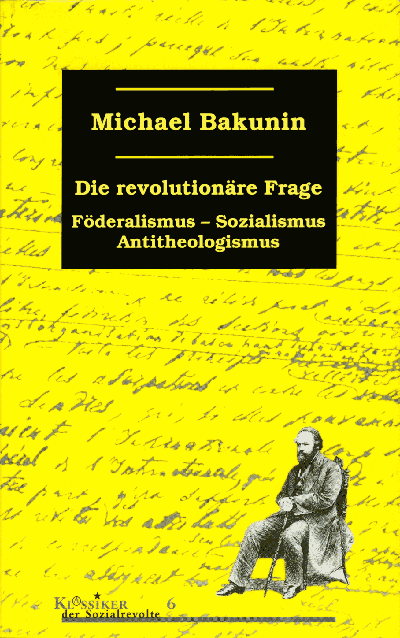
Wer bislang glaubte, die Publikation von Schriften des klassischen Anarchismus könne keine anregenden Überraschungen mehr zu Tage fördern, kann sich nun durch eine Neuerscheinung aus dem Münsteraner UNRAST-Verlag vom Gegenteil überzeugen lassen. Der im Oktober 2000 erschienene Band 6 aus der Reihe Klassiker der Sozialrevolte präsentiert zwei Texte Michael Bakunins (1814-1876), die für heutige Diskussionen gleich in mehrfacher Hinsicht Neues und Inspirierendes zu bieten haben: Bakunins Rede auf dem Gründungskongress der Friedens- und Freiheitsliga in Genf vom 10. September 1867 (S. 17-21) und seine zu derselben Zeit und aus gleichem Anlass entstandene Abhandlung Die revolutionäre Frage. Föderalismus, Sozialismus, Antitheologismus (S. 23-164).
Für die editorische Betreuung zeichnet in gewohnt souveräner Manier Wolfgang Eckhardt verantwortlich.[1] Mit seiner informativen Einleitung (S. 7-15) und dem detaillierten Anmerkungsapparat liefert er eine für das tiefergehende Verständnis unentbehrliche Einordnung in die historischen Zusammenhänge wie in die Werkgeschichte Bakunins. Das unbestreitbare Gelingen des anspruchsvollen Projektes verdankt sich weiterhin der Mitarbeit von Michael Halfbrodt, der mit einer kongenialen Übertragung aus den französischen Originalen einmal mehr eine sprachliche Kompetenz an den Tag legt, die nicht nur im Kontext der libertären Publizistik ihresgleichen sucht.[2]
Im Ergebnis ihrer Kooperation ist es Herausgeber und Übersetzer mit dieser deutschen Erstausgabe gelungen, einen in unserem Sprachraum noch ungehobenen Schatz anarchistischer Theoriebildung zu bergen. Mit Bakunins erstmaligem Versuch, seiner Vision von einer internationalen sozialen Revolution eine abschließende Form zu geben, können wir hier einer Sternstunde in der Ideengeschichte des Anarchismus beiwohnen. Gerade, dass er mit der europäischen „Friedens- und Freiheitsliga“ einen politisch keineswegs homogenen und schon gar nicht mehrheitlich sozialrevolutionären Adressaten vor sich hat, führt Bakunin bei der Fundierung seiner freiheitlichen Anschauungen bis an deren argumentative Wurzeln heran. Damit erreichen seine Ausführungen über weite Strecken ein politiktheoretisches Niveau von wohl einmaliger Qualität und inhaltlicher Systematik.
Im Laufe seiner brillanten Demontage autoritärer Gesellschaftskonzepte – ob sie nun vom Prinzip des Zentralismus ausgehen, sich auf die Staatstheorie vom sog. „Gesellschaftsvertrag“ berufen oder religiös motiviert sind – stößt Bakunin zielbewusst bis an die auch heute noch wirksamen Legitimationsversuche für die Herrschaft von Menschen über Menschen vor. In analytischer Treffsicherheit schält er als deren ideologisches Credo letzter Instanz „das Prinzip der Autorität“ heraus, „das heißt, jene im höchsten Maße theologische, metaphysische, politische Idee, daß die Massen immer unfähig sein werden, sich selbst zu regieren, und deshalb auf ewig das wohltätige Joch einer Weisheit und einer Gerechtigkeit werden tragen müssen, das ihnen auf die eine oder andere Weise von oben auferlegt wird“ (S. 140). Diesen nur allzu oft uneingestandenen Ausgangspunkt aller politologischen Diskurse in den Blickpunkt der kritischen Reflektion gerückt zu haben, ist allein schon von bleibendem Verdienst. Zumal Bakunin genau an dieser Stelle die Weiche umstellt und ebenso leidenschaftlich wie wohlbegründet sein antiautoritäres Konzept einer umfassenden individuellen Befreiung und gesellschaftlichen Selbstorganisation entfaltet.
Dem Prinzip der Staatlichkeit mit ihren zentralistischen und bürokratischen Gewaltstrukturen setzt er das Modell eines konsequent zu Ende gedachten Föderalismus entgegen: „Das Recht auf freie Vereinigung und ebenso freie Abspaltung ist das erste, das wichtigste aller politischen Rechte“ (S. 34). Interessanterweise hat Bakunins Plädoyer für einen vollständigen Abbau aller sozialen Zwangsverhältnisse in diesem Zusammenhang eine ausgesprochen antimilitaristische Note. Allein in einer lebendig vielgestaltigen, ebenso spontanen wie offenen Neustrukturierung des gesellschaftlichen Lebens von „unten“, von der Basis autonomer Initiativen, freier Kommunen und Gemeinden her, mit einem Wort: allein in der Anarchie, können sich nach Bakunin die dauerhaften Bedingungen eines internationalen Friedens verwirklichen. Seine diesbezüglichen Einsichten in den fatalen Teufelskreis von staatlicher Gewalt nach innen, Nationalismus und militärischer Expansion nach außen gehören zum Stärksten, was von anarchistischer Seite bisher zur Dialektik von Staat, Militarismus und Krieg gesagt wurde.
Einen weiteren Schwerpunkt bildet Bakunins eingehende Auseinandersetzung sowohl mit den sozialen Verheerungen kapitalistisch strukturierter Ökonomie als auch mit den in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstandenen Schulen des Staatssozialismus. Sein Fazit, „daß Freiheit ohne Sozialismus Privilegienwirtschaft und Ungerechtigkeit bedeutet; und daß Sozialismus ohne Freiheit Sklaverei und Brutalität ist“ (S. 62) hat auch 133 Jahre später nichts von seiner Aktualität verloren. Mit seiner Kritik an der Staatsfixiertheit und „Reglementierungswut“ (S. 48) der autoritären Sozialisten nimmt Bakunin den kurze Zeit später eskalierenden und in seinen Folgen für die internationale Arbeiterbewegung epochalen Zusammenstoß mit Karl Marx und dessen Jüngern inhaltlich bereits vorweg: „Sie hatten nicht begriffen, daß wir zwar die grundlegenden Prinzipien der zukünftigen Entwicklung darlegen können, daß wir aber die praktische Umsetzung dieser Prinzipien den Erfahrungen der Zukunft überlassen müssen“ (S. 47 f.).
Ohne Frage, hier bricht sich eine undogmatische Haltung Bahn, die aus dem Rohstoff des spontan sich entfaltenden Lebens zehrt und auf wohltuende Weise die starren Raster ideologischer Verengungen sprengt. In diesem Sinne ist in dem bemerkenswerten Buch noch viel für unsere Tage zu entdecken.
(Diese Rezension wurde erstmals veröffentlicht in: graswurzelrevolution. Für eine gewaltfreie, herrschaftslose Gesellschaft, Heidelberg, Nr. 252 / Oktober 2000, Libertäre Buchseiten, S. 4.
———————————————
Anmerkungen
[1] Eckhardt macht sich schon seit Jahren um eine seriösen Ansprüchen genügende Edition Bakuninscher Texte verdient und gab u.a. die Ausgewählten Schriften Bakunins im Berliner Karin Kramer Verlag heraus.
In dieser Reihe erschienen die folgenden Bände:
- Band 1: Gott und der Staat (1871), 6. aktualisierte, durchgesehene u. erweiterte Aufl., 2011, ISBN 978-3-87956-222-0, 162 Seiten.
- Band 2: „Barrikadenwetter“ und „Revolutionshimmel“ (1849). Artikel in der Dresdner Zeitung, 1995, ISBN 978-3-87956-223-7, 192 Seiten.
- Band 3: Russische Zustände (1849), 1996, ISBN 978-3-87956-231-2, 144 Seiten. [Direktkauf bei aLibro]
- Band 4: Staatlichkeit und Anarchie (1873), 3. Aufl., 2011, ISBN 978-3-87956-319-7, 555 Seiten.
- Band 5: Konflikt mit Marx. Teil 1: Texte und Briefe bis 1870, 2. Aufl., 2007, ISBN 978-3-87956-288-6, 240 Seiten.
- Band 6: Konflikt mit Marx. Teil 2: Texte und Briefe ab 1871, Zwei Halbbände, 2011, ISBN 978-3-87956-342-5, 1240 Seiten.
[2] Eine empfehlenswerte Probe seiner Qualitäten als Übersetzer lieferte Halfbrodt beispielsweise auch in der deutschen Ausgabe des mitreißenden Emigrationsberichtes Reisende ohne Namen von Louis Mercier Vega (aus dem Französischen übersetzt von Michael Halfbrodt), Hamburg: Edition Nautilus. Verlag Lutz Schulenburg, 1997.