Fritz Linow: Anarchismus. Aufsätze, Nachwort v. Hans Jürgen Degen, Berlin: OPPO-Verlag, 1991 (= Schriften des Libertären Forums Berlin; 2), ISBN 978-3926880048, 64 Seiten.
[Direktkauf bei aLibro]
Rezension von Markus Henning
Sicher dürfte der Kreis derjenigen, denen der Name Fritz Linow heutzutage noch etwas sagt, auch unter Libertären nicht allzu groß sein. Das war nicht immer so. In den 1920er Jahren hatte Linow (1900-1965) sich zu einem anerkannten Arbeits- und Sozialrechtsexperten der anarchosyndikalistischen Freien Arbeiter Union Deutschlands (FAUD) entwickelt; immerhin erwähnt kein geringerer als Rudolf Rocker (1873-1958) in seinen Memoiren unter „[…] den jugendlichen Genossen, die in der freiheitlichen Bewegung Deutschlands in jenen Jahren eine unermüdliche Tätigkeit entfalteten […]“[1] neben so bekannten Anarchosyndikalisten wie z.B. Augustin Souchy (1892-1984) und Helmut Rüdiger (1903-1966) ausdrücklich auch Fritz Linow.
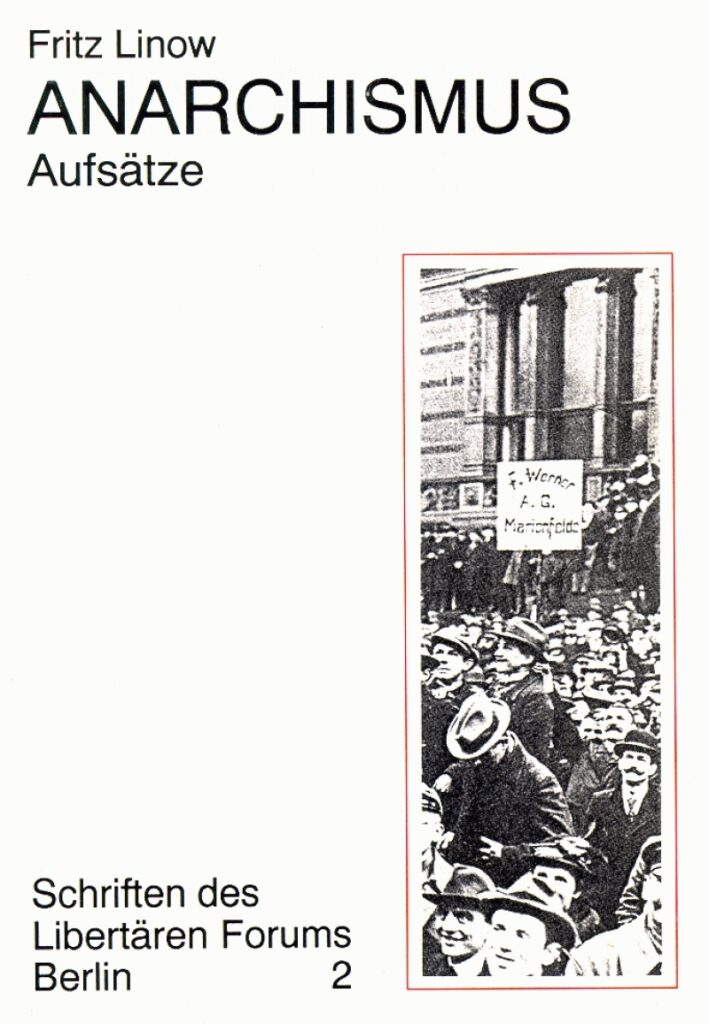
Auch in der 1947 gegründeten FAUD-Nachfolgeorganisation Föderation Freiheitlicher Sozialisten (FFS) machte sich Linow einen Namen. Insbesondere in seiner Funktion als leitender Redakteur der seit 1949 erscheinenden FFS-Zeitschrift Die Freie Gesellschaft trat er als eigenständiger Denker des freiheitlichen Sozialismus hervor. So bestimmte er maßgeblich die libertäre Nachkriegsdiskussion in Deutschland, die – Mitte der 1950er Jahre unter dem bleiernen Druck der Adenauer-Ära abgebrochen – heute so gut wie vergessen ist.
Ein Aufzeigen dieser verschütteten Tradition ist das Ziel des vorliegenden Bandes aus der Schriftenreihe des Libertären Forums Berlin. Mit ihm werden ausgewählte Artikel Linows aus den Jahren 1949-1953 erstmalig wieder einer größeren Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Ein verdienstvolles Anliegen, finden sich hier doch politische Haltungen und Denkansätze, die beispielhafte Anstöße zur Belebung aktueller anarchistischer Debatten liefern könnten.
Damit meine ich gerade auch die Auseinandersetzungen um Perspektiven eines zeitgemäßen Anarchosyndikalismus, die sich noch allzu oft in dem Rückgriff auf überlebte Konzepte der 1920er/1930er Jahre oder in anarcho-marxistischen Syntheseversuchen erschöpfen. Beidem erteilte Linow eine klare Absage. Aus den Erfahrungen mit der Nazi-Diktatur auf der einen, und dem Stalinismus auf der anderen Seite, zog Linow den Schluss, dass der libertäre Sozialismus konsequent alle anti-freiheitlichen Elemente abstreifen müsse. Nur so könne fortan jeglichem Totalitarismus erfolgreich widerstanden werden.
Das bedeutete für Linow zu allererst die Absage an vorgefertigte, eindimensionale Sozialismuskonzepte, in deren Ausschließlichkeitsanspruch er den Keim totalitärer Auffassungen erblickte. Von dieser Kritik nahm er auch den klassischen Anarchosyndikalismus nicht aus. Ein Sozialismus, der den Namen verdient, könne im Gegensatz dazu nur offen und pluralistisch sein. Den Erfordernissen der Zeit gerecht zu werden, hieß für Linow ebenso, sich endgültig von den naiven Revolutionskonzepten der Vorkriegszeit zu verabschieden. Der mechanistischen Vorstellung vom einmaligen revolutionären Umsturz setzte er das Konzept eines schon im heutigen kapitalistischen System zu beginnenden kulturrevolutionären Prozesses entgegen; revolutionärer Phraseologie entgegnete er mit pragmatischen Konzepten:
„[…] denn Sozialismus ist kein fertiges System, das man zu irgendeinem Zeitpunkt gegen den Kapitalismus auswechseln kann. Sozialismus ist fortschreitende Vergesellschaftung, d.h. eine willensmäßig beeinflusste Entwicklung, die die Elemente des Sozialismus, Freiheit und Genossenschaftlichkeit, Selbstbestimmung und Selbstverwaltung zum Tragen bringen will, weil diese Elemente die Grundlage bilden, auf der eine höhere Form der menschlichen Kultur erwachsen kann“ (S. 58).
Ein leitendes Motiv, das immer wieder in Linows Texten durchscheint, ist sein Bemühen um eine nüchterne und unvoreingenommene Einschätzung der realen gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse in der ihn umgebenden Gesellschaft und der sich daraus ergebenden Perspektiven für einen libertären Sozialismus. Dieser unbequeme Realismus verschaffte Linow nicht nur unter den Libertären seiner Zeit viele Opponenten. Auch heute noch hebt er sich wohltuend vom anarchistischen Zeitgeist ab, der sich eher in Stärke vortäuschender Selbstbespiegelung gefällt, als den – freilich recht ernüchternden – Tatsachenblick auf die eigene Stellung im gesellschaftlichen Gefüge zu wagen.
Fernab von jedem Wunschdenken legte Linow die Entwicklungstendenzen der Nachkriegsgesellschaft in Deutschland und Europa mit schonungsloser Offenheit dar:
„[…] die tätige Mitwirkung der Gesellschaftsmitglieder und das Recht ihrer Selbstkontrolle durch Selbstverwaltung ist auf der ganzen Linie in fortschreitender Auflösung. In immer weiterem Umfange wird Selbstverwaltung abgelöst durch einen in seinem Wesen verantwortungslosen Kontrollapparat, dem wir auf Schritt und Tritt in der bis zur Unförmigkeit aufgeblähten Sozialverwaltung begegnen und der uns als Bürokratismus – dem äußeren Merkmal eines werdenden Managerregimes – nur zu gut bekannt ist“ (S. 52).
Angesichts dieser Realitäten war für Linow eine direkte Umsetzung der gesellschaftlichen Zielvorstellungen des Anarchismus unmöglich; eine „Politik“, die sich mit der abstrakten Proklamation des anarchistischen Ideals begnügte, sah er demzufolge zur Wirkungslosigkeit verurteilt. Eine wirkliche Perspektive konnte der freiheitliche Sozialismus nach Linow nur dann gewinnen, wenn es ihm gelang, libertäre Prinzipien punktuell in die kapitalistische Gesellschaft hineinzutragen, um so „[…] Ausblicke [zu eröffnen] auf mehr Freiheit und weniger Regierung; auf mehr Selbstverwaltung und weniger Staat; auf mehr Mitbestimmungsrecht der Arbeit und weniger Wirtschaftsautokratie; auf mehr funktionelle und weniger institutionelle Demokratie, also auf mehr Genossenschaftsgeist und effektiven Kommunalismus; auf mehr Dezentralisation und echten Föderalismus und weniger bürokratische Totalität […]“ (S. 43 f.).
Was Linow vor dem Hintergrund der fortschreitenden Bürokratisierung aller Bereiche der modernen Massengesellschaft als konkrete Handlungsmaxime vorschlug, war die konsequente Unterstützung all derjenigen gesellschaftlichen Kräfte, die sich für eine „Vertiefung und Verbreiterung der Demokratie“ einsetzten:
„[…] der freiheitliche Sozialismus hat die Aufgabe, solche Bestrebungen zu ermutigen, denn sie sind Teil seiner selbst, weil sie zur Restrukturierung der Gesellschaft beitragen. […] [Er kann] sich nicht zur Wirkung bringen, wenn er nicht der Gesellschaft gegenüber dem Staat das Übergewicht schafft […]“ (S. 57 f.).
Eine solche Politikkonzeption konnte nicht länger von einem verengten syndikalistischen Klassenstandpunkt ausgehen: Nicht die Wirtschaft alleine, sondern die Gesamtheit aller Lebenssphären – besonders aber die kommunalpolitische Ebene – hatte Linow im Blick, wenn er die Libertären zur aktiven Mitarbeit in den Basisbewegungen, „[…] den öffentlichen Foren, den Bürgerschutzgemeinschaften, den Nachbarschaften, den Wählergesellschaften usw. […]“ (S. 58) aufforderte. Sein voluntaristischer Appell galt keineswegs nur den Mitgliedern der Arbeiterklasse, sondern richtete sich an alle Individuen gleichermaßen:
„Es gibt Sozialismus, wenn wir ihn wollen, wenn wir unsere Kämpfe um neue Lebensformen an die Quellen der gesellschaftlichen Existenz in Wirtschaft und Kultur verlegen, wenn wir das Leben – unser privates, unser berufliches und unser öffentliches Leben – mit sozialistischer Geisteshaltung durchdringen, wenn wir Zivilcourage und Rückgrat beweisen gegenüber den Mächten des Besitzes und der Gewalt“ (S. 50).
Bei der Suche nach vorwärts gerichteten Perspektiven können die Thesen Fritz Linows auch heute noch allen Libertären eine inspirierende Lektüre sein. Dies gilt auch für seine eher zeitbezogenen Ausführungen, etwa zur Zusammenbruchsituation nach 1945 und den sich daraus ergebenden Perspektiven für eine föderalistische Neuordnung Europas, oder für seine Kritik an der sich anbahnenden Wiederaufrüstung der BRD. Denn immer begegnet uns Linow in dem Bemühen, praktikable Antworten auf die zeit- und situationsbedingten Fragen des politischen Alltags zu entwickeln, ohne dabei den Bezug zu den großen gesellschaftlichen Visionen des Anarchismus preiszugeben.
In dieser Herangehensweise vorbildlich und produktiv kann die Auseinandersetzung mit den hier gesammelten Aufsätzen Linows allen Interessierten nur wärmstens empfohlen werden.
Deutlich wird zudem, dass die libertäre Diskussion der Nachkriegszeit wiederzuentdecken und die Gründe ihrer fehlenden Kontinuität bis in die heutigen Tage zu analysieren sind. Ich denke, es gäbe viel daraus zu lernen.
(Diese Rezension wurde erstmals veröffentlicht in: A-Kurier. 14-tägiges anarchistisches Infoblatt, Berlin, Nr. 24 / 6.4.1992, S. 16 f.)
———————————————
Anmerkungen
[1] Rudolf Rocker: Aus den Memoiren eines deutschen Anarchisten, hrsg. v. Magdalena Melnikow u. Hans Peter Duerr, Einleitung v. Augustin Souchy, Nachwort v. Diego Abad de Santillán, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1974 (= edition suhrkamp; 711), S. 361.