Gerhard Senft: „Auf uns sind die Blicke der Welt gerichtet…“ Die Rätebewegung in Ungarn 1919, Wien: Edition FZA, 2019, ISBN: 978-3-903104-10-5, 152 Seiten
[Direktkauf bei aLibro]
Rezension von Markus Henning
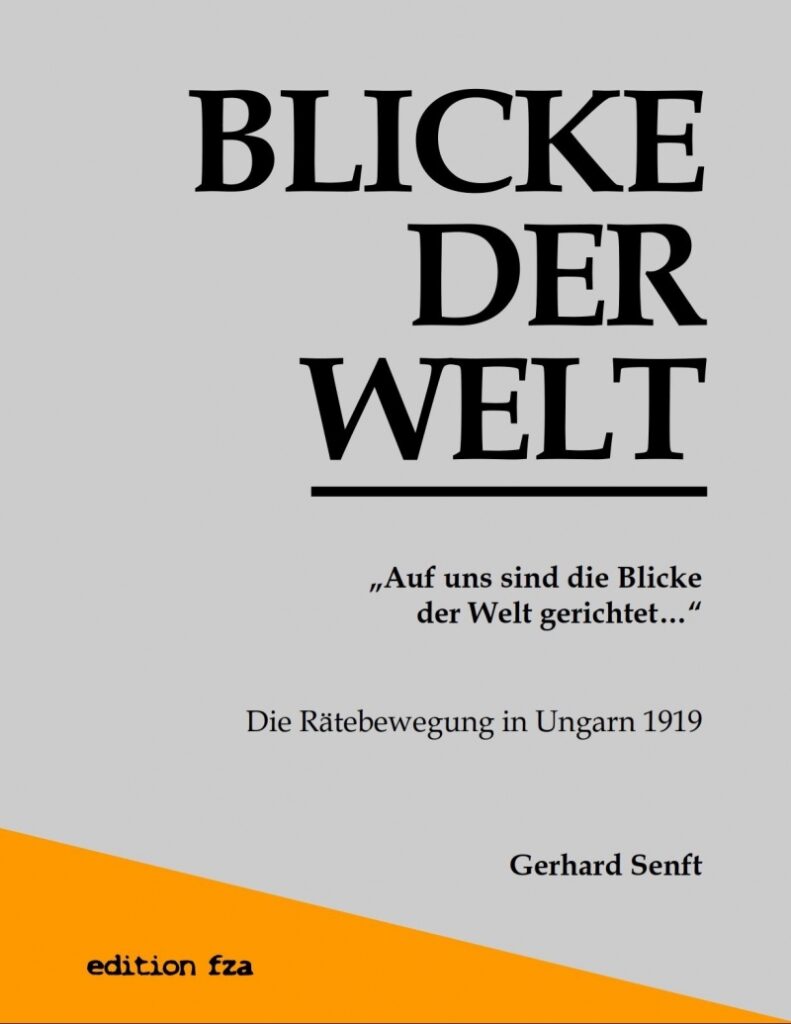
Revolutionen sind für wagemutige Journalisten ein Eldorado. Vor gut hundert Jahren zog es den jungen Joseph Roth im Auftrag einer Wiener Tageszeitung nach Ungarn. Eine Reise, auf die uns Gerhard Senft im Anhang seines neuen Buches mitnimmt (S. 113 ff.). In Budapest war am 22. März 1919 die „Föderative Ungarische Sozialistische Räterepublik“ ausgerufen worden. Vielleicht war es gerade seine ironische Distanz, die Roth zum unbefangenen Zeitzeugen machte. Seine Reportagen aus den ländlichen Regionen Westungarns sind feinsinnige Mentalitätsstudien mit einem klaren Blick für ungelöste Strukturkonflikte: „Der Terror der in der Gegend herumvagabundierenden Räuber, die die Organisation der ‚Leninbuben‘ bildeten, die ewigen Requisitionen, Alkohol- und Tanzverbote der Räteregierung, nicht zum geringsten Teil auch ihre Geldmisswirtschaft erweckten in den Bauern das Verlangen, Ungarn Lebewohl zu sagen […]“ (J. Roth, zit. nach S. 118).
Anfänglich hatte Räteungarn wie ein Lichtstrahl der Hoffnung gewirkt. Der lang ersehnte Brückenkopf eines Revolutionskorridors von Russland bis Bayern! Das Fanal einer basisdemokratischen Umwälzung weiter Teile Europas!
Und doch waren es nicht allein territoriale Gebietsverluste und militärischer Druck von außen, die das Experiment nach gut vier Monaten zum Scheitern brachten. Im Inneren selbst hatten autoritäre Machtpolitik und sozialökonomische Konfusion Bevölkerungsvertrauen zerstört und wichtige Mobilisierungseffekte untergraben.
Das Völkergemetzel des 1. Weltkrieges war auch in Ungarn erst durch eine Aufstandsbewegung der Arbeiter- und Soldatenräte beendet worden. Ihre Selbstverwaltungsorgane wurden im Verlauf der Räterepublik mehr und mehr zu bloßen Befehlsempfängern degradiert. Faktisches Herrschaftszentrum war der 27-köpfige „Revolutionäre Regierende Rat“. In ihm dominierten „Volkskommissare“ der „Ungarischen Sozialistischen Partei“, allen voran der Lenin-Gesandte Béla Kun.
Ihr zentralistisches Ordnungssystem ließ selbst die ambitioniertesten Vorhaben zur Erneuerung des halbfeudalen Landes in Bevormundung und Günstlingswirtschaft umschlagen. Verstaatlichung unter Beibehaltung des alten Führungspersonals! Die Fremdbestimmung am Arbeitsplatz blieb für die allermeisten Beschäftigten auch unter der „Diktatur des Proletariats“ bestehen. Sowohl in Fabriken und Dienstleistungsbetrieben, als auch in der Landwirtschaft. Güter mit über 57 Hektar wurden enteignet und direkt in Staatsbetriebe bzw. in landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften eingebracht, die vom Regime kontrolliert wurden. Autonome Besetzungsaktionen und Ansätze selbstverwalteter Bewirtschaftung wurden mit Gewalt rückgängig gemacht. „Das Landproletariat und die kleinen Bauern mussten schließlich zu der bitteren Erkenntnis gelangen, dass die ‚Bodenreform‘ ihren Namen nicht verdiente und sich im Grunde nichts veränderte“ (S. 48).
Auch im Bereich der Geldpolitik blieb eine zukunftsfähige Weichenstellung aus: Abschaffung des allgemeinen Tauschvermittlers! Naturalwirtschaft auf Basis von Arbeitszeit-Quittungen! Das waren die Parolen der ersten Wochen. Ihre Umsetzung endete im Fiasko. Auch später gelang es noch nicht einmal im Ansatz, der Ökonomie ein tragfähiges monetäres Fundament zu geben. Eine galoppierende Inflation entfaltete ihre destruktive Dynamik und steuerte die ungarische Gesellschaft in die Katastrophe.
Die offenkundige Hilflosigkeit der Räteregierung in Wirtschafts- und Finanzfragen führt Gerhard Senft sehr schlüssig auf ihre handlungsleitende Ideologie zurück. Im Marxismus-Leninismus wird dem Geldsektor eine nur untergeordnete Rolle zugeschrieben. Eine Ignoranz, die typisch ist für viele Konzeptionen zentralistischer Ökonomie.
Bei dieser dogmengeschichtlichen Einordnung lässt Senft es aber nicht bewenden. Ein eigenes Kapitel widmet er geldpolitischen Alternativentwürfen, die in der revolutionären Umbruchszeit 1918/19 ebenfalls diskutiert wurden, im Gegensatz zu den ungarischen Maßnahmen jedoch „[…] über einenerheblichen innovativen Charakter verfügten“ (S. 53). Hierunter fallen Wirtschaftsreformer wie Ulrich von Beckerath oder Jakob Hans Hollitscher (späterer Rechtsbeistand des Währungsexperiments in Wörgl), allen voran aber Silvio Gesell und sein Wirken für Freiland und Freigeld in der Münchener Räterepublik.
Damit liefert Senft weit mehr als einen historischen Rückblick. Seine Untersuchung weist in die ordnungspolitische Zukunft: Wie kann eine Geld- und Bodenreform mit basisdemokratischen Prinzipien so verbunden werden, dass sie allen Menschen ein erfülltes Leben in Selbstbestimmung und freier Vereinigung ermöglicht?
(Diese Rezension wurde erstmals veröffentlicht in: Fairconomy, Jg. 15 / Nr. 3 – September 2019)