Pierre-Joseph Proudhon: Handbuch des Börsenspekulanten, hrsg. v. Gerhard Senft, Wien / Berlin: LIT Verlag, 2009, ISBN 978-3-643-50028-1, 313 Seiten
[Direktkauf bei aLibro]
Rezension von Markus Henning
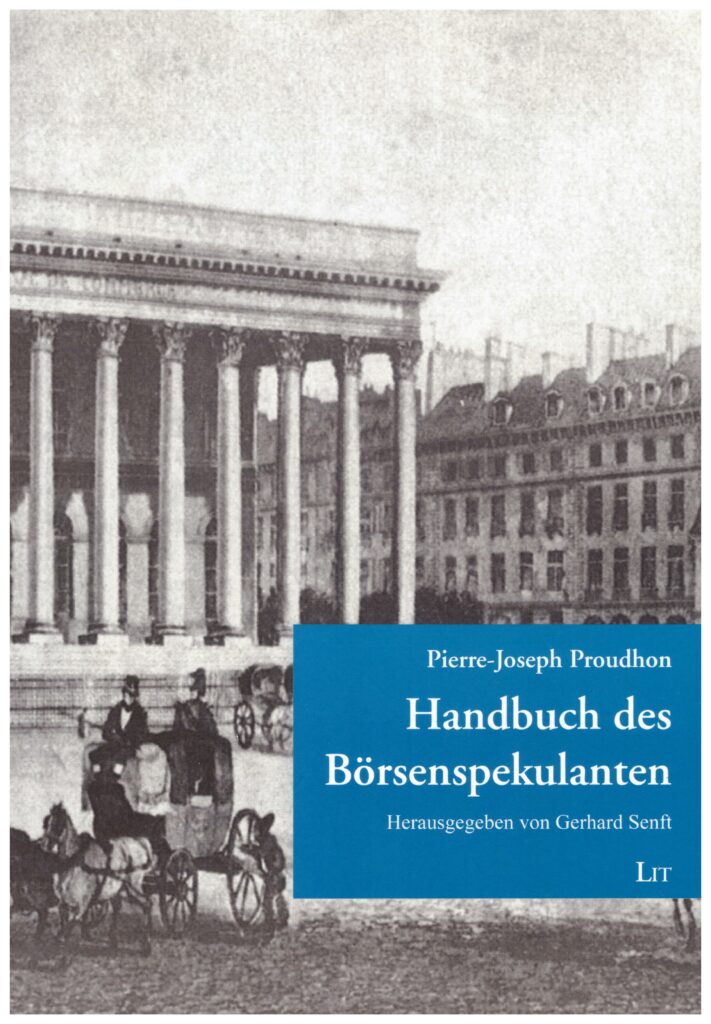
Die internationalen Finanzplätze sind der Ort, an dem sich die verborgene Triebfeder kapitalistischer Zivilisation im Auf und Ab von Euphorie und Depression, von Panik und Manie eruptionsartig Bahn bricht. In kollektivem Spekulationsfieber werden hier je nach Spiellaune und Zufall Entscheidungen über Krieg und Frieden getroffen, Katastrophen verhütet oder herbei gewettet. Katastrophen, die ganze Nationalökonomien, soziale Systeme und internationale Beziehungen in den Abgrund zu reißen imstande sind. Selbst die Legion der Leidtragenden wird von der kulturprägenden Gier nach schnellem Gewinn um jeden Preis erfasst. Kurz: „Die Börse vorzugsweise ist das Wahrzeichen der heutigen Gesellschaft“ (S. 17).
Eine Zustandsbeschreibung, wie direkt auf unsere Gegenwart gemünzt und doch mehr als 150 Jahre alt. Abgegeben wurde sie von Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) im Handbuch des Börsenspekulanten, einem bisher selbst von erklärten Anhängern des großen französischen Sozialisten meist unterbewerteten Werk. Die pünktlich zum Proudhon-Jahr 2009 im LIT Verlag erschienene Neuauflage ist durchaus geeignet, dieses Urteil dauerhaft zurechtzurücken und einen – wie wir meinen – vorwärtsweisenden Zugang zu eröffnen.
Zu verdanken ist das vor allem der methodisch reflektierten und didaktisch gelungenen Bearbeitung durch ihren Herausgeber Gerhard Senft, mittlerweile emeritierter Professor an der Wirtschaftsuniversität Wien, Aktivist der Pierre-Ramus-Gesellschaft und ausgewiesener Kenner libertärer Ökonomiekonzepte. Auch ohne spezielle Vorkenntnisse gut lesbar hat Senft dem historischen Text (S. 1-182) zwei materialreiche und am neuesten Forschungsstand orientierte Arbeiten aus eigener Feder an die Seite gestellt: Die Schauplätze der Finanzmarktentwicklung (S. 189-265) zeichnen die Ausformungen des modernen Finanzmarkt-Kapitalismus in ihrer von spekulativen Exzessen und globalen Krisen geprägten Abfolge nach und liefern so die wirtschaftsgeschichtliche Folie für ein tieferes Verständnis der von Proudhon behandelten Thematik. Das Nachwort: Pierre-Joseph Proudhon und die Anfänge der Finanzkapitalkritik (S. 277-310) stellt die externen Rahmenbedingungen und den unmittelbaren Entstehungshintergrund des Handbuchs dar, verdeutlicht seinen Stellenwert im Proudhonschen Gesamtwerk und fördert denkwürdige Details seiner vielfach untergründigen Wirkungsgeschichte zu Tage.
In ihr manifestiert sich die Ausstrahlungskraft einer ideengeschichtlichen Pioniertat aus profanem Anlass: Vorrangig aus Gründen des Broterwerbs hatte der knapp ein Jahr zuvor aus politischer Haft entlassene Proudhon 1853 einen Gelegenheitsauftrag seines Pariser Verlegers für einen Leitfaden durch die Welt der Börse übernommen und den späteren Kommunarden Georges Duchêne (1824-1876) zur Mitarbeit gewinnen können. Im Verlauf ihrer empirischen Studien hatte sich Proudhon die grundlegende Bedeutung des Projektes allerdings immer deutlicher enthüllt. Nachdem sich die beiden ersten Ausgaben der Jahre 1854 und 1855 mit dem Börsenbetrieb noch fast ausschließlich aus technischer Perspektive beschäftigt hatten, erweiterte Proudhon das Manuel du spéculateur à la Bourse schließlich für eine dritte Auflage 1857 zu einer umfassenden Monographie über die Geld- und Kapitalmärkte, ihre hegemoniale Stellung im kapitalistischen Wirtschaftssystem und ihre strukturelle Krisenhaftigkeit.
Der Politischen Ökonomie seiner Zeit eröffnete Proudhon hiermit ein völlig neues Forschungsfeld. Ein analytischer Startschuss mit spürbarem Widerhall auch im frühsozialistischen Lager, in dem bis dahin etatistische Regulierungswut und eine entsprechend schlicht gehaltene Geldschelte den Ton angegeben hatten. Im Gegensatz hierzu war ökonomische Analyse bei Proudhon immer auch Herrschafts- und Staatskritik, durch die soziale Phantasie angeregt, gesellschaftliche Selbstorganisation und föderale Vernetzung initiiert werden sollten.
Eine hieran ausgerichtete Lesart legt uns Gerhard Senft auch heute für das Handbuch des Börsenspekulanten nahe, das er in der überarbeiteten Form einer zeitgenössischen Übersetzung ins Deutsche (Hannover 1857) präsentiert. Dabei zeigt sich, dass Proudhons Finanzkapitalkritik aktuelle Überzeugungskraft gerade daraus schöpft, dass sich ihre Maßstäbe aus einem anarchistischen Gesellschaftsideal ableiten.
Für den gegenwärtigen Diskurs über die internationale Finanz- und Bösenkrise, ihr Übergreifen auf die Realwirtschaft und das weltweite Nachbeben in exorbitant anschwellenden Staatsverschuldungen können Proudhons Analyse wichtige Orientierungshilfen entnommen werden. Ebenso erhellend wie humanisierend wirkt seine Kritik allein schon durch ihre strukturelle Ausrichtung, der es nicht um individuelle oder gruppenbezogene Schuldzuweisungen, sondern um grundsätzliche Konstruktionsfehler des sozialen Systems zu tun ist. Auf methodischer Ebene korrespondiert damit das zur Maxime erhobene Prinzip einer möglichst einfühlsamen Annäherung an die zu beschreibende Realität in ihrer oft ambivalenten Vielgestaltigkeit: Durchgängig bemüht Proudhon sich darum, die sozialökonomischen Triebkräfte und Einrichtungen (z.B. Geld, Kredit, Spekulation, Freihandel, technischer Fortschritt) einerseits in ihrer positiven Bedeutung zu würdigen, andererseits aber auch ihre negativen Überformungen und deren Ursachen zu durchdringen. Diese Differenzierungsarbeit und die aus ihr sich ergebenden Schlussfolgerungen sind wesentlich auch für das Verständnis von Proudhons tauschsozialistisch orientierten Reformvorstellungen.
Proudhon konstatiert eine ökonomische Machtzusammenballung im Börsenbereich, die durch die Verschmelzung mit den konzentrierten Kapitalien aus Produktion, Handel und Dienstleistung alle Züge einer finanzaristokratischen Feudalherrschaft annimmt. Historisch wie systematisch führt er sie zurück auf den Einbruch staatlicher Gewalt in das Geld- und Kreditwesen: Insbesondere das vom Staat garantierte Geldmonopol erweist sich als herrschaftlich gesetzte Blockade im Zirkulationsprozess, die eine tiefe Sozialspaltung der Gesellschaft hervor treibt. Die eigentumslose Bevölkerungsmehrheit ist von den Mitteln für eine gleichberechtigte Teilnahme am Marktgeschehen ausgeschlossen, da das staatliche Monopolgeld Kreditvergabe und die Bedingungen des Produktenaustauschs den besitzenden Klassen vorbehält. Damit verewigt es die Ausbeutung der Werktätigen durch die verschiedenen Formen des „arbeitslosen“ Einkommens und erzeugt über den Zinsmechanismus ein wechselseitiges Aufschaukeln von exklusiven Vermögensanhäufungen auf der einen und sozialen Verschuldungstendenzen auf der anderen Seite.
Abhilfe und grundsätzliche Umkehr sind von regierungsamtlicher Intervention nicht zu erwarten. Unter dem Leitbild Die industrielle Demokratie: Vereinigung der Arbeit oder allgemeine Gegenseitigkeit; Ende der Krisis (S. 161-173) setzt Proudhon stattdessen auf den Aufbau einer netzwerkartigen Gegenökonomie von der gesellschaftlichen Basis her. Über praktische Selbstaufklärung in der Schule des Experiments gilt es, eigene Fähigkeiten zu entdecken, egalitäre Zusammenschlüsse zu erproben und gerechte Tauschbeziehungen einzugehen. Nicht allein um ein alternativwirtschaftliches Sozialbiotop zu etablieren, sondern mit dem erklärten Ziel, die bestehenden Strukturen des kapitalistischen Wirtschaftssystems dynamisch zu unterwandern und an ihre Stelle eine monopolfreie Ordnung zu setzen.
An die bisher Benachteiligten richtet Proudhon daher den dringenden Appell, selbst aktiv zu werden und möglichst ohne Verzug und in eigener Regie an die Gründung von Produzentenvereinigungen, Unternehmenskooperationen, Konsumgenossenschaften, Tauschgesellschaften zu gehen und in ihrem wirtschaftlichen Verkehr die Potentiale einer befreiten Zirkulationssphäre modellhaft zu entfalten: Umgehung des staatlichen Monopolgeldes durch frei zu schöpfende Währungen, Tausch-Bons oder andere Geldsurrogate bzw. direkter Austausch von Arbeit gegen Arbeit und Neuorganisation des Kreditverkehrs auf Basis gegenseitiger Bürgschaften und zinsloser Darlehen. Dem gesellschaftlichen Kriegszustand des Kapitalismus, wie er in der modernen Börsenkultur handgreiflich Ausdruck gewinnt, soll auf diese Weise langfristig „[…] ein ungeheures Ganzes von Öffentlichkeit, Gleichgewicht und Kontrolle […]“ (S. 29) entgegenwachsen, auf politischer Ebene eingebettet in den Abbau zentralistischer Staatsgebilde zugunsten autonomer Kommunen und ihrer Verbände.
Mit diesem Blick in die Zukunft gewinnt Proudhons Handbuch des Börsenspekulanten einen Aktualitätsbezug, der noch über den eigentlichen Gegenstand seiner inhaltlichen Analyse hinausweist. Zeitlos ist sein Voluntarismus des sozialen Beginnens, ohne welches sich substantiell einfach nichts in Richtung Freiheit bewegen kann. Konstruktive Anregungen könnten ihm aber auch entnommen werden, um bereits bestehende Ansätze gegengesellschaftlicher Infrastruktur weiterzuentwickeln und in einem libertären Gesamtkonzept strategisch zusammen zu führen.
Wir wünschen ihm eine möglichst weite Verbreitung.
(Diese Rezension wurde erstmals veröffentlicht in: espero. Forum für libertäre Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung, Berlin / Neu Wulmstorf, Jg. 17 / Nr. 64 – Juni 2010, S. 37-40)